Wenn Ihr Team ständig darauf warten muss, bis Übersetzungen nachgeliefert werden, ist es Zeit für eine bessere Lösung.
Dieser Leitfaden erklärt, wie kontinuierliche Lokalisierung funktioniert, warum sie für agile Teams entscheidend ist und wie ein solcher Workflow konkret aussieht.
Warum klassische Übersetzungsabläufe die agile Entwicklung ausbremsen
Die herkömmliche Vorgehensweise stammt noch aus Zeiten des Wasserfallmodells: Erst wird das Produkt fertig entwickelt, dann geht der gesamte Textbestand an das Lokalisierungsteam, das alles in einem separaten Schritt übersetzt.
Diese Arbeitsweise ist zu starr für moderne Entwicklungsprozesse.
Agile Softwareentwicklung ist dagegen iterativ, mit häufigen Updates und Releases. Wird ein statischer Übersetzungsprozess darübergestülpt, entstehen Blockaden.
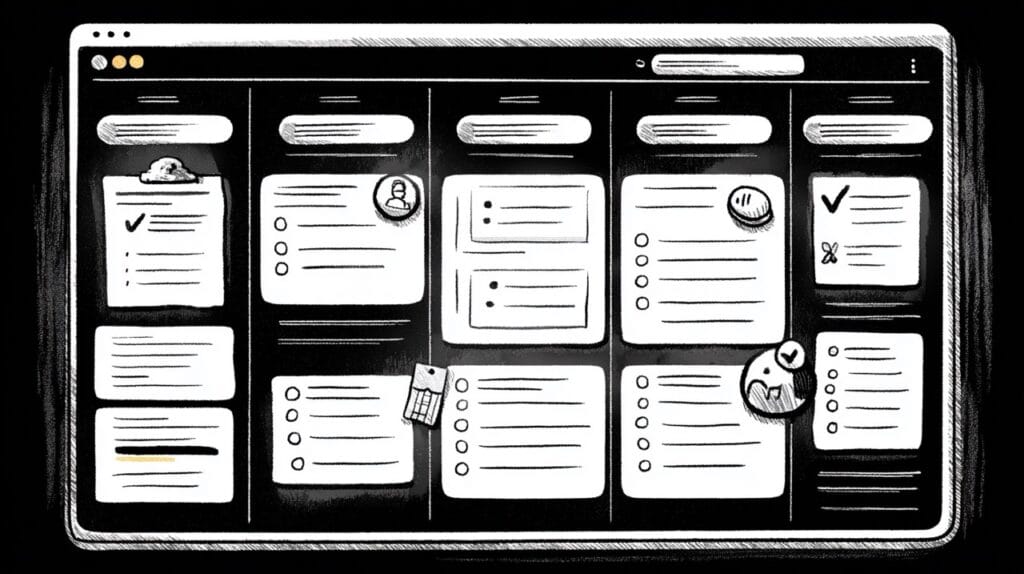
Entwickler warten auf fertige Übersetzungen, das Lokalisierungsteam versucht permanent, aufzuholen. Diese Reibung bremst Skalierung und Time-to-Market aus.
Wie kontinuierliche Lokalisierung in Produktzyklen integriert wird
Kontinuierliche Lokalisierung ist kein einmaliger Schritt, sondern ein durchgehender Prozess, der parallel zur Entwicklung läuft. Dahinter steckt die nahtlose Integration von Tools, damit Übersetzung und Entwicklung jederzeit synchron bleiben.
Der Ablauf startet bereits in dem Moment, in dem ein Entwickler seinen Code ins zentrale Repository eincheckt. Das ist an sich Teil jedes agilen Workflows. Der Unterschied: Dieser sogenannte Commit löst automatisch den Lokalisierungsprozess aus – ein manuelles Extrahieren von Texten ist nicht mehr nötig.
Sobald neue Strings erkannt werden, übernimmt die Automatisierung. Ein Webhook schiebt die Quelldateien direkt in ein angebundenes Translation Management System (TMS). Das Lokalisierungsteam erhält sofort die Info, dass neuer Content zu übersetzen ist.
Im TMS selbst können die Übersetzer sofort loslegen. Ist die Übersetzung abgeschlossen, läuft der Prozess in umgekehrter Richtung: Das System synchronisiert die lokalisierten Strings automatisch zurück ins Repository. Die Übersetzungen sind damit direkt Teil des Codes und stehen jederzeit für Releases bereit. So können Updates gleichzeitig in mehreren Sprachen veröffentlicht werden.
Wichtige Bausteine eines agilen Lokalisierungsprozesses
Ein guter agiler Lokalisierungsablauf lebt davon, dass Menschen und Technologie reibungslos zusammenarbeiten. Dieser Prozesswandel beseitigt die traditionellen Silos zwischen den Teams. Entwickler müssen sich nicht mehr um String-Dateien kümmern und können sich ganz auf das Schreiben internationalisierbaren Code konzentrieren. Produktmanager erhalten direkten Einblick in die Pipeline und können Release-Zyklen gezielt steuern und planen.
Das Lokalisierungsteam wird so vom nachgelagerten Dienstleister zu einem echten Partner. Es arbeitet parallel zu den Entwicklungssprints und hat das Ziel, präzise und hochwertige Übersetzungen zu liefern, ohne den Prozess auszubremsen.

Das Rückgrat dieses Workflows bildet die passende Lokalisierungstechnologie, die speziell dafür entwickelt wurde, Übersetzungen direkt in die Entwicklung zu integrieren. Im Zentrum steht dabei ein modernes TMS wie zum Beispiel Localazy, eine Art Plattform oder Software, die genau diese Aufgabe erfüllt. Sie verbindet sich direkt mit dem Code-Repository und automatisiert den Austausch von Strings. Innerhalb dieses Systems kann maschinelle Übersetzung eine erste Rohfassung erzeugen, die anschließend von Profis überarbeitet wird.
Vorteile eines Continuous-Delivery-Ansatzes
Der Umstieg auf diesen Workflow bringt fast sofortige Vorteile: Besonders stark wirkt sich die kontinuierliche Lokalisierung auf die Verkürzung der Time-to-Market aus, da Übersetzungen deutlich schneller abgeschlossen werden. Weil die finale Übersetzungsphase wegfällt, kann man neue Funktionen in allen Sprachen gleichzeitig veröffentlichen.
Das verbessert direkt die Nutzererfahrung internationaler User. Wenn Lokalisierung Schritt hält mit der Produktentwicklung, bekommen Nutzer in allen Sprachen Updates zur gleichen Zeit.
Zudem lässt sich das Lokalisierungsprogramm leichter skalieren. Ein Kernstück jeder erfolgreichen Lokalisierungsstrategie ist die Fähigkeit zur Expansion. Wenn neue Märkte erschlossen werden sollen, wird das Hinzufügen einer neuen Sprache nicht mehr zu einem Großprojekt, sondern läuft als planbarer Bestandteil des Entwicklungszyklus.
Wie kontinuierliche Integration den Prozess unterstützt
Um kontinuierliche Lokalisierung umzusetzen, müssen Technologie und Teamstruktur gemeinsam gedacht werden. Der erste Schritt: die richtigen Tools auswählen. Ein TMS mit robuster API ist Pflicht. Ebenso wichtig ist es, das Entwicklerteam mit klaren Prozessen und Best Practices zur Internationalisierung vorzubereiten.
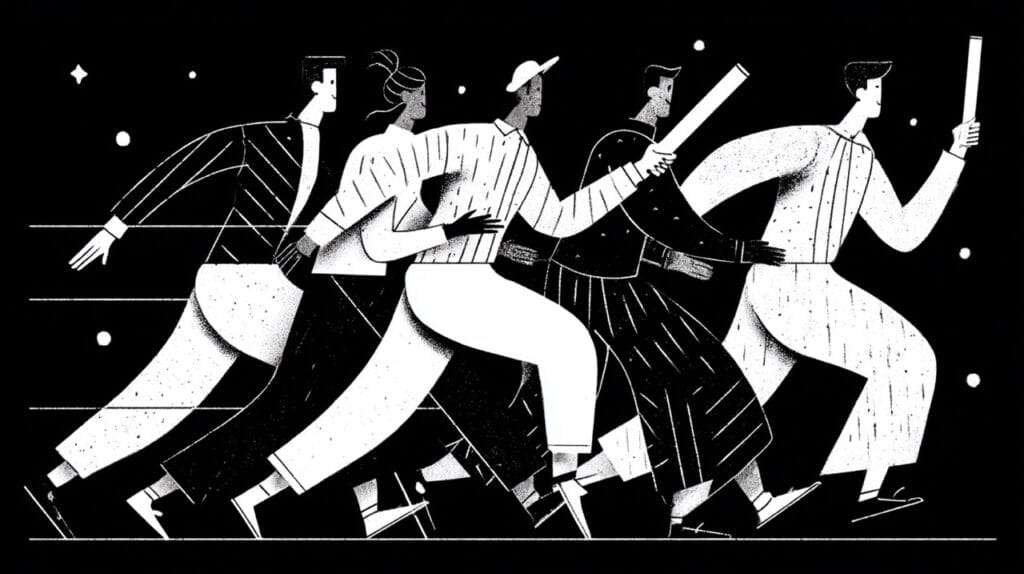
Als Nächstes muss eine Entscheidung bezüglich eines Lokalisierungmanagement-Ansatzes getroffen werden. Baut man ein internes Team auf und stellt einen dedizierten Lokalisierungsmanager ein? Oder arbeitet man lieber mit flexiblen Übersetzungsdienstleistern oder einem Full-Service-Partner? Diese Entscheidung legt fest, wer die Workflows im TMS einrichtet. Ein guter Dienstleister mit umfassendem Übersetzungsservice kann hier von Anfang an begleiten.
Für wen sich dieser Ansatz eignet
Ist dieser Prozess also wirklich passend? Für statische Einzelprojekte wie Vertrags- oder Broschürenübersetzungen wäre ein automatisierter Workflow überdimensioniert. Aber wenn Ihr Start-up agil arbeitet und Software für ein mehrsprachiges Publikum entwickelt, ist die Antwort eindeutig ja. Die kontinuierliche Lokalisierung ist für jedes agile Team das fehlende Element für eine effektive Softwarelokalisierung.
